2023 ist fast aufgebraucht, wir melden uns wieder zum Küren der Jahresbesten. Es freut uns ganz besonders, dieses Mal unseren langjährigen Herzensfreund Carsten mit dabei zu haben. Er wird, Ehre wem Ehre gebührt, die Platzierungen auch anführen. Schon jetzt zeigt sich, dass er wesentlich auskunftsfreudiger ist als wir zwei krummen, maulfaulen Birken. Was für eine Freude!
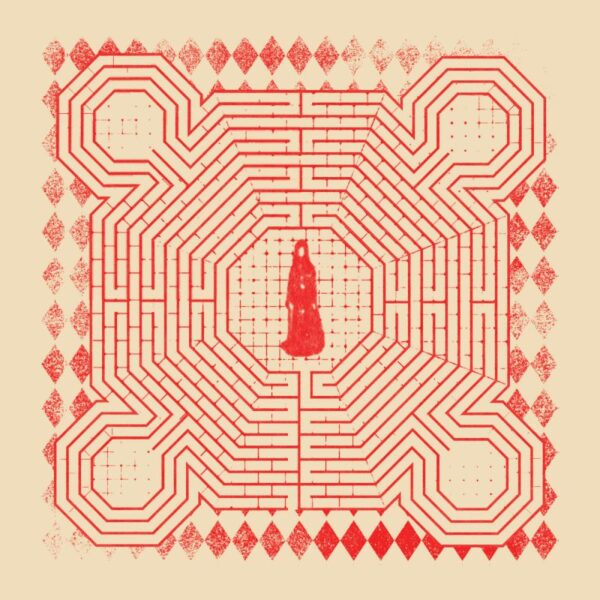
Carstens Nr. 10:
Slowdive – Everything is alive
(Dead Oceans)
Ich würde ja gerne behaupten, damals dabei gewesen zu sein. Aber als Slowdive 1993 „Souvlaki“ veröffentlicht haben, ihr unverständlicherweise wie ein Grillspieß benanntes zweites Album, da war mir „Wild Wood“ von Paul Weller irgendwie näher. Oder auch das Debüt von Björk. Eigentlich ging das fast allen so, denke ich. Das, was später Shoegaze hieß, war Anfang der 90er nur ein Nachklapp des vorherigen Jahrzehnts, und meiner Meinung nach damals schon von den Cocteau Twins abschließend erläutert. Auch der Chef des Slowdive-Labels Creation, Alan McGee, hat im selben Jahr das Hallpedal verschämt in Blisterfolie gepackt, und lieber eine Teenieband namens Oasis gesignt. Nun gut, hinterher verklärt sich das alles. Ich denke ja auch immer, ich wäre ein Mod gewesen.
Heute ist Shoegaze und das überlappende Dream Pop-Genre ein fester Bestandteil der Internet-Indie-Szene, aber neben einem Wust an soßig klingenden Homerecordings gibt es da nur wenige echte Highlights. Da kommt dem neuen Slowdive-Album eine ganz praktische Bedeutung zu. Jetzt gilt ihr Frühwerk als stilbildend, ja epochal. Und das führt bizarrerweise dazu, dass „Everything is alive“ heute viel erfolgreicher ist, als Slowdive es früher jemals waren. „30 years on, and their music just gets BETTER????“, schreibt jemand auf YouTube. Da habe ich ob der Wahrheit mal gekichert. Gibt bestimmt Poptheoretiker, die darüber nochmal sinnen wollen, und optional einen Bezug zu den Joy Division T-Shirts bei H&M herstellen.
Aber ich bin ja fürs Pragmatische: Das Album klingt so, wie Dream Pop laut Spotify heute klingen soll, ätherisch, mit mehr Waber- als Gitarrenfundament, schwebender Doppelgesang, Shimmer-Reverb, you get the idea. Sehr geschmackvoll und auch trickreich gemacht. Vor allem „kisses“ (natürlich klein geschrieben) ist eine Blaupause für die aktuelle playlistenkonforme Interpretation des Genres. Könnte alles etwas rotz- und noisiger sein, denke ich mir noch. Aber dann, beim 4. Durchlauf erinnere ich mich plötzlich überdeutlich, wie Slowdive damals total mein Leben verändert haben, 1993 mit „Souvlaki“ war das, und ihre Rückkehr jagt mir Schauer über den Rücken. Welch epochales Comeback. Vor allem für mich. Dem Shoegazer der ersten Stunde.
::

Rolands Nr. 10:
Melenas – Ahora
(Trouble in Mind)
Meiner Erinnerung nach ein letztes Geschenk von Twitter, also per Empfehlungslink drauf gestoßen, bevor ich jene Müllgrube endgültig verließ. Scheint mir eine schöne Abschlusspointe, so ausgerechnet auf eine spanischsprachige Frauenband zu stoßen – weil das (dem Klischee nach) nicht dem Geschmack eines Muskfanboys entsprechen sollte, dem eines Musikfanboys aber schon. Melenas als spanische Stereolab zu verkaufen, ist vielleicht ein bisschen stark, aber in die Richtung geht es. Es schweineorgelt übers ganze Album hinweg, geht immer ordentlich geradeaus und ist zwar retro, aber keine langweilige 1:1-Reproduktion von Vorgängigem.
::

Gregors Nr. 10:
Arooj Aftab, Vijay Iyer & Shahzad Ismaily – Love in Exile
(Verve)
Kontinentale Klanglandschaften aus Atem, Wummern und hypnotischen Klavierlinien. Dieses friedvolle Miteinander der verschiedensten Instrumente ist schon beachtlich, das harmonische Miteinander in jedem Ton spürbar. Ich wusste gar nicht, dass man beim Musizieren so viel Rücksicht aufeinander nehmen kann, also hörbar gestalteter Respekt. „Love in Exile” ist ein kleiner, großer Trip, für den man sich Zeit nehmen muss, sehr viel Zeit. Steht sehr im Widerspruch zu den konsumistischen Färbungen unserer Übermaß-Gesellschaft, gerade deshalb sollte man sich direkt einen Therapieplatz sichern.
::

Carstens Nr. 9:
CVC – Get Real
(CVC Recordings)
So ein wenig der Schlachtruf der Indiepop-Szene 2023 ist das schon, „Get Real“. MGMT haben kurz vor Schluss noch einmal bei Oasis angedockt und das 90er-Songwriting entdeckt, und CVC aus Wales (Wales! Da wo Robbie Williams und Tom Jones herkommen! Und die Stereophonics!) feiern den gekonnten AOR-Rock von Fleetwood Mac („Knock Knock“), America und den amerikanischen Roots Rock („Woman of Mine“). So wie überhaupt Wales immer dick in the USA war. Natürlich immer mit einem schlauen Blick auf das, was im zeitgenössischen Indieradio machbar ist („Music Stuff“). Da nickt die Hipsterin gefällig, da freut sich der ergraute Radioredakteur.
Der klassische Adult Rock der Westküste, er ist nicht nur spießige Kulisse für Rockisten wie Thomas Gottschalk und Toto verehrende Bass-Spieler in ihrem Mancave, sondern auch eine ewige Inspiration für moderne Geschmacksübungen mit Bandmaschine und Harmoniegesang. Auf dem Album groovt und wohltönt es aus allen Ecken. Wer es ironisch finden muss, um es auszuhalten, von mir aus. Funktioniert aber auch in echt.
Was es vor allem aufgerauht charmant macht: Die – selbstverständlich Moustache tragenden – Waliser sind immer noch ungebügelt, die Studioaufnahmen etwa 1,2 Millionen Dollar billiger, und das nasale Gesundheitsbewusstsein viel größer als bei den Vorbildern damals in Sausalito und dem Laurel Canyon. Beim Satzgesang von Francesco Orsi und seinen Kumpanen ist die Haltung denn auch größer als die Perfektion. Keine Zitatesammlung also, sondern ein unaufdringlich geschichtsbewusstes und gut durchblutetes Rockrevival.
::
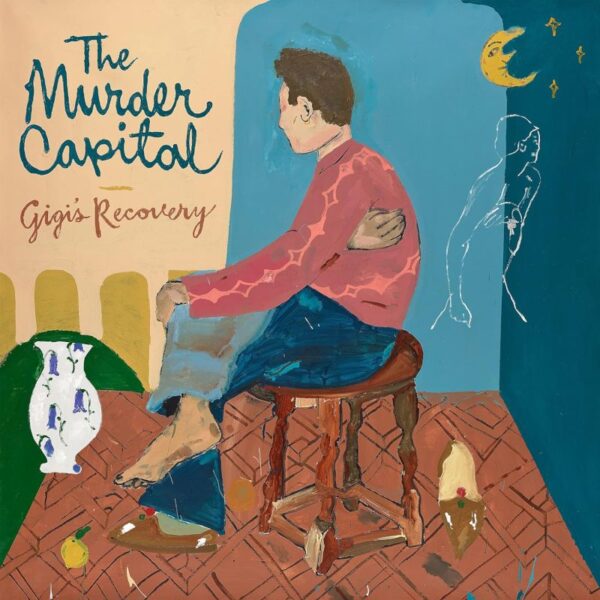
Rolands Nr. 9:
The Murder Capital – Gigi’s Recovery
(Ada)
Die nächste gefeierte Dubliner Postpunkband, gab’s gefühlt die letzten Jahre jedes Jahr eine von. Ich springe trotzdem gern auf den Hypetrain, denn es wird eben ordentlich raufgewummst, der Schlagzeuger spielt mit den dicken Stöcken, Gitarren haben ausreichend Schmackes und Drive, dazu gibt’s glasklaren, croonernahen Gesang (bei etwas generischen Texten allerdings). Gute Mischung aus Druck und Melodie also – dürfte meiner Zielgruppenanalyse nach deshalb durchaus in die mittelgroßen Hallen führen. Würde ich mir tatsächlich selbst auch gerne live geben.
::

Gregors Nr. 9:
Wednesday – Rat Saw God
(Dead Oceans)
Wie soll ich das jetzt in zwei Sätzen erklären? Dieser ganze 70er-, 80er- und 90er-Kram hat ja nie wirklich ein Ende gefunden, alle drei Musikjahrzehnte stehen letztlich für eine ganze Epoche, die so schnell nicht enden wird. Heißt im Fall von Wednesday: Die 90er sind mal mehr und mal weniger ständig und überall, auch in „Rat Saw God“. Klasse Album, das bereits fünfte Wednesday-Album in fünf Jahren von der Hinterland-Band aus Asheville, North Carolina. Im Kern geht es in den Songs um die Jugend von Sängerin Karly Hartzman und das man nicht unbedingt in der Großstadt wohnen muss, um im Alkoholrausch vor das Haus der Eltern zu kotzen. Es geht also auch um die eigene Jugend. Musikalisch passiert ebenfalls unfassbar viel Spannendes, von Pixies bis Country, von Screamo bis Fuzz alles dabei! Shout out loud!
::
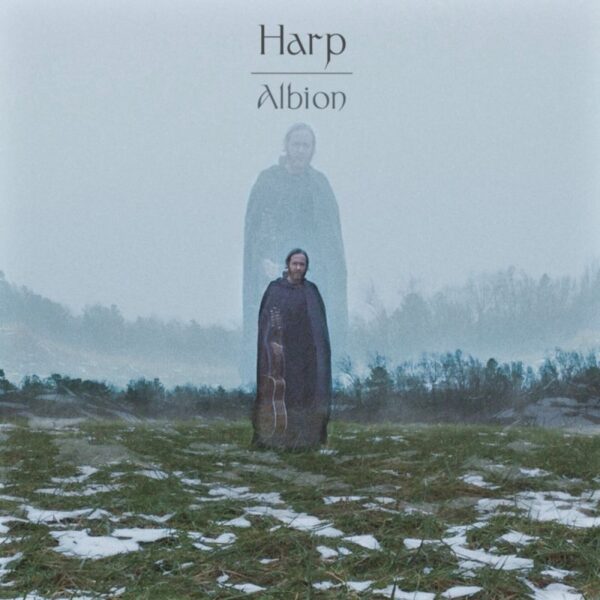
Carstens Nr. 8:
Harp – Albion
(Bella Union)
Zu den auffälligsten Bands der Nuller- und Zehnerjahre gehören für mich ja Midlake, die komplizierten Musikstudenten aus Denton, Texas. Auf dem von den Cocteau Twins Robin Guthrie und Simon Raymonde gegründeten Bella Union Label erschienen, wie so viele wichtige Künstler der Ära (Beachhouse, John Grant, Fleet Foxes). Mit zwei bezwingenden Alben („The Trials of Van Occupanther“, „The Courage of Others”), die den britischen Folk der 70er und die feinsinnige Eleganz von Lindsay Buckingham mit dem zarten Gesang von Tim Smith zu einem intimen, melancholischen Kosmos verbanden. Voller Naturlyrik und Introspektion. Und wahrscheinlich brutal anstrengenden Studiodiskussionen. Nerds eben. Und dann auch noch ausgebildete Jazzer. Klingt übel.
Tatsächlich kam es dann auch zum Beatles-Moment, und Smith verließ, sich selbst anklagend, den Rest der Band, nachdem er die Sessions des Nachfolgealbums unerträglich in die Länge gequatscht hatte. Eine Katastrophe. Midlake wandelten sich in der Zeit danach zu einer eher nur okayen Muckertruppe. Und Smith? Ich habe ihm 2013 auf Facebook geschrieben, seine Songs gepriesen, und, wie viele andere, ungeduldig um ein Soloalbum gebettelt. Schließlich hatte er schon eine Website mit dem vielversprechenden Bandnamen „Harp“ in die Welt gesetzt. Er hat mir geantwortet, war ganz sensibler und dankbarer Künstler, und eine Mailingliste angeführt, auf der er sich bei den Fans melde.
Hat er auch. So alle 2 Jahre. Kunst hier, Scheidung da, Geduld hier, Umzug und neue Heirat dort. Und dann, vor wenigen Monaten – 10(!)Jahre später: „Ich bin fertig.“ Ich habe fast geweint. Nein, nicht fast.
Und nun? Er macht da weiter, wo er aufgehört hat. Mit all der Mystik und Zartheit und ich war bei der ersten Single „I am the seed“ völlig entrückt. Allerdings hat er nun nach eigenem Bekunden die 80er entdeckt. Heißt, er lobpreist Baritongitarren mit Chorusdröhnerei und fummelt mit einem JX8P-Synthesizer rum. Und findet Faith toll. Das schwarzweißeste Cure-Album. Ist prinzipiell zu begrüßen, allerdings wird es, wenn er wie bei „Throne of Amber“, dann im Mittelaltermarkt-Cape durch den Nebelwald hetzt, auch ein wenig – lieber Tim, verzeih – albern. Es gibt eben Zeitgeistmomente, die lassen sich nicht in die Gegenwart holen. Doch sei es drum. Er ist wieder da. Und es ist ein Debüt. Vielleicht rüttelt sich dann bei der nächsten Platte 2031 alles wieder zurecht. Ich bleib dran, wir schreiben, Tim, gell?
::
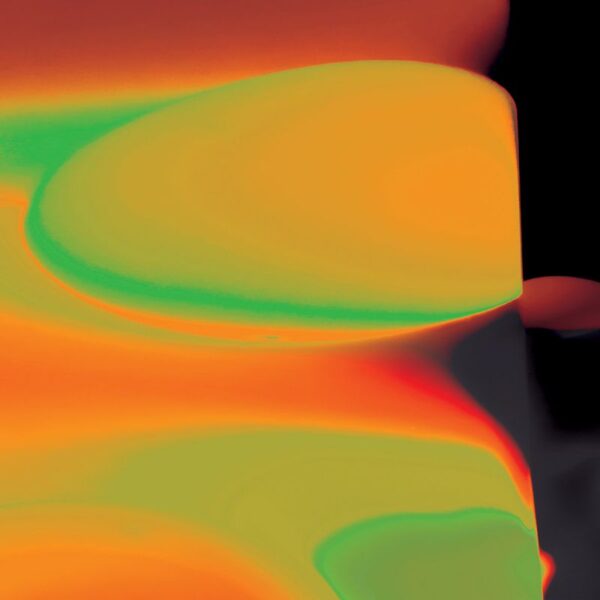
Rolands Nr. 8:
Anthony Naples – orbs
(ANS)
Ein Slowburner, gilt sowohl für die Musik selbst als auch für deren mähliche Wirkung. Ambientartiges, mit deutlichen Dubtechno-Einflüssen. Bewusste Zeitlupe gleich zu Anfang, die ersten schweren Basslinien setzen ein, alles irgendwie sehr erwachsen, ganz gemach und unspektakulär. Ein gutes Begleitalbum. Bei mir etwa im Einsatz gewesen auf nächtlichen Heimwegen durchs nasskalte Berlin – Asphaltpfützen, in denen Neonleuchten sich spiegeln, dürfte tatsächlich die ziemlich genaue visuelle Entsprechung hierfür sein – beschallte mich auch sehr gut während konzentrationsintensiver Arbeitstätigkeiten (weil: ausreichend eintönig und doch abwechslungsreich genug).
::

Gregors Nr. 8:
P.J. Harvey – I Inside the Old Year Dying
(Partisan)
Und noch mal Coming-Of-Age. PJ Harveys zehntes Album basiert auf ihrem Gedichtband „Orlam“ von 2022. Darin wird die Geschichte eines neunjährigen Mädchens erzählt, die im kleinen Dorf Underwhelem im Westen Englands aufwächst und dort die Unschuld ihrer Kindheit hinter sich lässt. Harvey schrieb die Gedichte in einem alten Dorset-Dialekt, an den sie sich noch aus ihrer Jugendzeit erinnerte. “Voul village in a hag-ridden hollow. All ways to it winding, all roads to it narrow” – Underwhelem ist ein übler Ort der Gewalt und des Aberglaubens. Wen man wie ich Nick Cave für den größten lebenden Songwriter der Gegenwart hält, kommt man nicht umhin, in P.J. Harvey das weibliche Pendant zu erkennen. Polly ist eine betörende Erzählerin und eine meisterhafte Virtuosin, ihr Gespür für Geheimnisvolles im übergroßen Raum der Melodie unerreicht. Auf dem Album finden sich neben dem klassischem Instrumentarium jede Menge Field Recordings, die sie zum Teil von Sounddesignern zur Verfügung gestellt bekommen hat, die sie beim Komponieren von Theatermusik kennenlernte. Das muss man sich dann so vorstellen: „Kann ich Wind haben, der im November durch einen Stacheldrahtzaun bläst?“ Die Antwort: „Yeah, here you are!“
::

Carstens Nr. 7:
bar italia – Tracey Denim
(Matador)
Tempo, Tempo. Wenn die Hype-Maschine Londons angesprungen ist, dann gilt es keine Zeit zu verlieren. Für gewöhnlich bleibt dann ein halbes Jahr, in dem sich entscheidet, ob Tüllrock oder Plateausandalen nun wirklich heiß, oder total peinlich sind. Bar Italia wissen das natürlich, und haben 2023 gleich zwei Alben rausgehauen. Das Letzte schon fast glamourös im Homestudio auf Mallorca. Wahrscheinlich um dem Druck zu entgehen. Aber während die im November erschienene Sammlung „The Twits“ versucht, es allen recht zu machen („Auch mal was Fetziges“, „Mehr von euch beiden im Duett“, „Mehr wie Velvet Underground klingen“), und dabei so ein wenig bemüht wirkt, hat „Tracey Denim“ dieses Problem noch nicht.
Karg und lakonisch blättern Nina Cristante, Sam Fenton und Jezmi Fehmi da durch dicke Ordner mit Copyshop-Flugblättern und verhuschten Schwarzweissbildern. Spröde und introspektive Songs. Klingeling-Gitarren, auch mal mit etwas Fuzz-Gesumme und ein Gesang, der nie mehr als 70% gibt. Einprägsame Hooks kommen eher da eher durch Zufall durch.
Hornbrillen-Postpunk, der gut abgehangene Referenzen von Stereolab bis Sonic Youth durchscheinen lässt. Breites Grinsen nonstop beim Hörer. Und trockener Slackerhumor auf der Bandseite: „yes i have eaten so many lemons yes I am so bitte”, heißt da ein Song, ein Perspektivwechsel auf Kate Nashs Boyfriend-Diss „Foundations“. Mainstream ist halt Mist. Bitte dringend dabei bleiben.
::

Rolands Nr. 7:
Yo La Tengo – This Stupid World
(Matador)
Yo La Tengo eher Name als Erfahrung für mich. Klar, immer wieder mal drüber gestolpert, aber nie wirklich intensiv gehört. Ob das vorliegende Album nun ihr vierzehntes oder siebzehntes ist, keine Ahnung, warum dieses plötzlich aus allen Richtungen empfohlen und besprochen wurde, weiß ich nicht, ob es aus dem bisherigen Oevre besonders hervorsticht, mag ich nicht zu beurteilen. Das erzeugte Echo jedenfalls hat genügt, dass ich es mir mal bewusster angehört habe und also drauf hängenblieb. Wer die ruhigeren Sonic-Youth-Sachen mag, wird das auch mögen. Ganz offenbar eine gut gealterte Band und die Platte selbst dürfte sich auch gut halten.
::
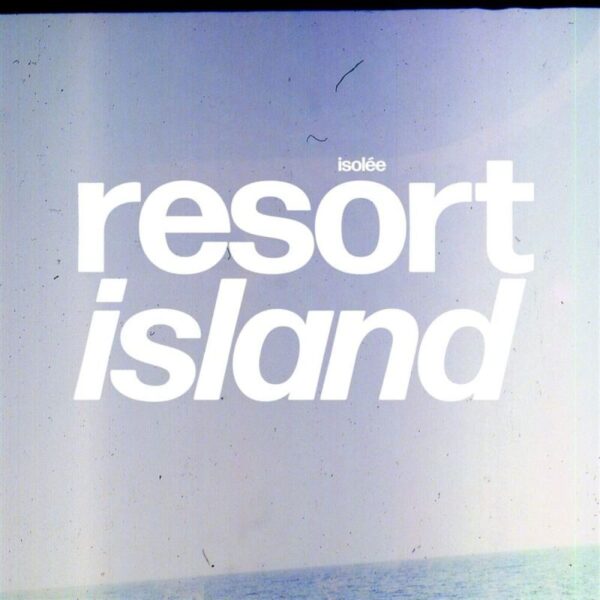
Gregors Nr. 7:
Isolée – Resort Island
(Resort Island)
Zwölf Jahre nach seinem letzten Album „Well Spent Youth“ auf Pampa Records gibt’s endlich Nachschub von Rajko Müller alias Isolée und ich möchte mal vorsichtig behaupten: das vierte ist zugleich sein bestes Album. Das ist insofern erstaunlich, als dass er seine Kunst schon vor 25 Jahren zur Meisterschaft geführt hat. Wenn es nach seinen hohen Ansprüchen geht, besteht die große Herausforderung wahrscheinlich darin, sich nicht zu wiederholen, was mit wachsender Schaffenszeit einen beträchtlichen Raum einnehmen dürfte. Und überhaupt: Isolée wollte ja immer Musik für den Strand machen, aber nicht Teil der Party sein. Lässig, aber nicht belanglos. Optimistisch, aber nicht oberflächlich. Hellklar produziert und trotzdem eigenwillig. Das kann dann alles ganz schnell konstruiert klingen, tut es aber nicht. „Resort Island“ ist ein Album für Träumer und Isolée bleibt für mindestens weitere zwölf Jahre der Liebling des Undergrounds.
::
