Machtdose Webradio No. 3
Sooo. Ich hab ein ein bisschen nachgedacht, wie man das Webradio / den Podcast sinnig fortsetzen könnte, herausgekommen ist:
Was ich mit der Sendung ab sofort versuche, ist, das Webradio und die Journey-through-netaudio-Zusammenstellungen miteinander zu verbinden: D. h. es wird ein Podcast über Netlabel-Veröffentlichungen sein. Künftig soll es ca. einmal im Monat einen Überblick mit den meiner Meinung nach besten Netlabel-Tracks aus den Wochen zuvor geben. Im Webradio schwatze ich noch jeweils was dazu und spiele nicht unbedingt jeden Titel in voller Länge aus.
Ich werde aber auch, wie bei den vorigen Zusammenstellungen, die Tracks mit den entsprechenden Soundfile-Links auflisten, dass man sie sich einzeln runterladen kann oder die Gesamtliste (ohne mein Radio-Gelaber und voll ausgespielt) per M3u-File als Stream anhören kann. (Hässliche Cover bleiben deshalb auch weiterhin).
Die jetzigen Sendung ist nochmals elend lang geworden, trotzdem ich einiges eben nur anspielte, nämlich etwas über eine Stunde und 15 Minuten. Sie umfasst schwerpunktmäßig ungefähr die letzten zwei Monate und noch einige ältere Tracks, die mir über den Weg liefen. Sollte ich es mit der monatlichen Sendung schaffen, dann hoffe ich, mich bei den folgenden Sendungen im Bereich von 6 bis 12 Stücken und also 20 – 45 Minuten bewegen zu können, was – glaube ich – podcastgemäßer ist.
Diesmal ging es in der Sendung unter anderem darum, wie ich selbst eigentlich beim Netlabel-Nachforschen vorgehe. Ich habe dafür (eher für mich, aber vielleicht auch für andere interessant) eine Seite mit kommentierten Links [Edit: im Moment noch in der Mache und nicht fertig] eingerichtet, die die für mich wichtigsten Ansteuerungspunkte / Bezugsquellen enthält. Auf der Seite fehlt allerdings ein Link, den ich im Podcast erwähne, und zwar der zum Artikel bei Phlow über Musicweblogs mit Netlabel-/Netaudio-Schwerpunkt.
Bleibt mir nur, jetzt die Titel aus der Sendung in der Reihenfolge ihres Auftretens anzugeben und darauf hinzuweisen, dass natürlich wie immer jegliche Kommentare zur Sendung, zu einzelnen Stücken, zur Auswahl der Titel, Tipps zu Weiterem oder was auch immer hochwillkommen sind:
Playlist:
- Skism (12rec.net) – GBS (1:56) mp3
- Gorowski (WM Recordings) – Spaced Rums (2:12) mp3
- Sensual Physics (Epsilonlab) – Cold Sweat (6:22) mp3
- Akan (Plex Records) – Narcolepsy (7:56) mp3
- Troupe (Backtrack) – This Is (4:00) mp3
- Thomas Mæry (Sundays in Spring) – Shaping Places (4:16) mp3
- D-Rockets (Mr. Furious Records) – Bottom of the Pool (3:58) mp3
- Audio Mjao (corpid) – Swimming in dirty water (2:32) mp3
- Psync (sublogic corporation / flow) – Breek (5:25) mp3
- Gigaboy (Comfort Stand) – Xu-Xu (3:00) mp3
- Megaheadphoneboy (OpenLab Records) – rush (3:01) mp3
- Dave Seagrim (Nishi) – Pulse (4:55) mp3
- Tammy + Gurtz (Filtro) – Roller (5:28) mp3
Andrew Duke (Phoniq sowie Stratagem) – Carnival (6:36) mp3- Mombus (Laridae) – Bad Weather (4:27) mp3
- Nelson (Free Sample Zone) – Pauvre Con (4:27) mp3
- Cryo & Checkpoint Charlie (Bevlar) – Resources (Patrick Fridh’s Frosty Fairlight Remix) (7:31) mp3
Dumb Dan (Bevlar) – Ele (5:31) mp3- esem (Kahvi Collective) – legho (send someone off to their dreams) (4:24) ogg
- Sr. Click (inoquo) – Spring (6:18) mp3
Sumergido (Sinergy Networks) – Buenas Noches (2:33) mp3
Gesamtlänge: 1:36:47
Podcast: Download (Duration: 1:16:03 — 69.6MB) | Embed
Subscribe: Apple Podcasts | RSS
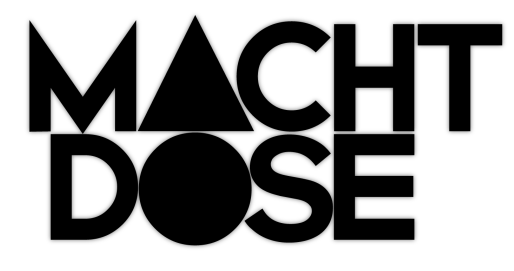

 Zwei der wohl tollsten Kreativmeister grade haben sich also zusammengetan: Das alte Eisengesicht MF Doom, der (zusammen mit Madlib) im letzten Jahr das sich ständig selbst überbietende „Madvillainy“ rausbrachte und DJ Dangermouse, der ungefähr zeitgleich den Mashup-Bastard „Grey Album“ (Jay-Z meets the Beatles) ins Netz schickte und eine Riesenaufregung erzeugte, einmal wegen der daraus entstehenden Musikindustrie-Hysterien, nicht zuletzt aber auch, weil das Ergebnis tatsächlich aufregend frisch und neu klang.
Zwei der wohl tollsten Kreativmeister grade haben sich also zusammengetan: Das alte Eisengesicht MF Doom, der (zusammen mit Madlib) im letzten Jahr das sich ständig selbst überbietende „Madvillainy“ rausbrachte und DJ Dangermouse, der ungefähr zeitgleich den Mashup-Bastard „Grey Album“ (Jay-Z meets the Beatles) ins Netz schickte und eine Riesenaufregung erzeugte, einmal wegen der daraus entstehenden Musikindustrie-Hysterien, nicht zuletzt aber auch, weil das Ergebnis tatsächlich aufregend frisch und neu klang. Munk, Headman, Mocky, Kamerakino, The Rammellzee, Hiltmeyer Inc.: So langsam mausert sich das Münchner Label Gomma mit ein bisschen gutem Willen zu dem gegenwärtig besten Label dieses Planeten. Und jetzt
Munk, Headman, Mocky, Kamerakino, The Rammellzee, Hiltmeyer Inc.: So langsam mausert sich das Münchner Label Gomma mit ein bisschen gutem Willen zu dem gegenwärtig besten Label dieses Planeten. Und jetzt 
 Ebenso wie die Songs von
Ebenso wie die Songs von  Ich mag Großbritannien, ich mag auch die Briten, Kreidehaut und Sommersprossen, ihr Assogetue, Spaßprügeln, Hardcore-Pubismus und die Kreativität ihrer Subkulturen nebst Nähe zur Allgemeinheit. Mittlerweile kann ich sogar ihrem blöden Abweichlertum ein bisschen was abgewinnen – diese Inselaffen. Und das alles nur, weil sie wissen, wie man Musik macht.
Ich mag Großbritannien, ich mag auch die Briten, Kreidehaut und Sommersprossen, ihr Assogetue, Spaßprügeln, Hardcore-Pubismus und die Kreativität ihrer Subkulturen nebst Nähe zur Allgemeinheit. Mittlerweile kann ich sogar ihrem blöden Abweichlertum ein bisschen was abgewinnen – diese Inselaffen. Und das alles nur, weil sie wissen, wie man Musik macht.  Treue Fans der Gruppe werden mir wahrscheinlich nicht zustimmen, aber Sigur Rós haben mit Takk (EMI) ihr bisher bestes Album gemacht. (Kann man sich übrigens
Treue Fans der Gruppe werden mir wahrscheinlich nicht zustimmen, aber Sigur Rós haben mit Takk (EMI) ihr bisher bestes Album gemacht. (Kann man sich übrigens